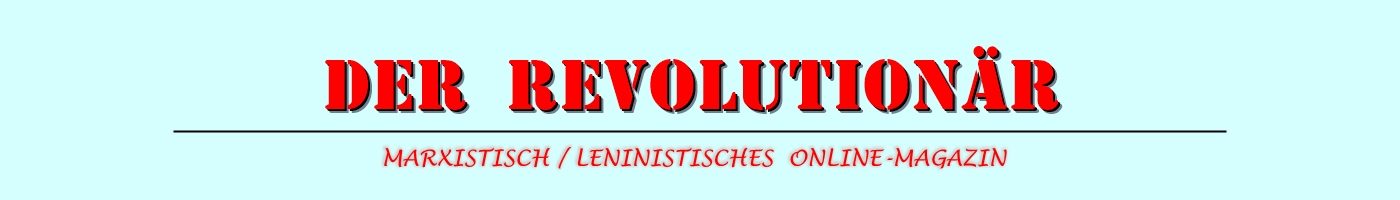Als sich am 26. Dezember 1991 die Sowjetunion – gegründet von Lenin am 30. Dezember 1922 – auflöste, wurde jede kommunistische Grundsatzkritik am Kapitalismus als überholt, absurd oder bedeutungslos abgetan. Doch schon damals war es falsch, marxistisch-leninistische Analysen zu ignorieren. Eine ernsthafte Untersuchung der Ursachen für den Zerfall der UdSSR kann nur im Rahmen marxistischer Theorie stattfinden, die die Wertform der Ware als grundlegendes Element der bürgerlichen Gesellschaft erkennt. Je mehr Warenproduktion herrscht, desto mehr werden die Produzenten vom Produkt beherrscht – sie werden zu Spielbällen ihrer eigenen Arbeit.
Von Heinz Ahlreip – 22. April 2025 | Drei Jahrzehnte später hat sich der Blick auf die Geschichte gewandelt. Ohne ein gründliches Studium des Marxismus-Leninismus ist der Zusammenbruch der Sowjetunion nicht begreifbar – erst recht nicht durch bloße Faktenhäufung oder die Aussagen politischer Meinungsmacher von damals.
Die Marxisten-Leninisten sind im 20. Jahrhundert, trotz des historischen Aufbruchs 1917, politisch nicht verwöhnt worden: Die Sowjetunion ist gefallen, die DDR zerschlagen, die RAF zerschlagen, China zum kapitalistischen Eldorado verkommen – mit Parteibuch im Dior-Anzug. Die Bilanz wäre trostlos, hätte nicht die Rote Armee unter Stalins Führung 1945 den Faschismus besiegt.

Hätten nicht Pioniere wie Alexej Stachanow 1935 im Bergbau Weltrekorde gesetzt.
Hätte nicht Gagarin 1961 den ersten Schritt ins Weltall gewagt,


gefolgt von Walentina Tereschkowa – bis heute die einzige Frau, die allein ins All flog.
Technische Grundlagen des Kommunismus
Für eine kommunistische Gesellschaft sind unter anderem drei Voraussetzungen nötig: die unbegrenzte Entwicklung von Produktion, Produktionsmitteln und Produktivkräften. Doch bürgerliche Historiker haben die Produktion stets für zweitrangig gehalten – wichtiger schienen ihnen Ideen, große Persönlichkeiten und moralische Konzepte. So blieb ihnen der historische Materialismus verschlossen.
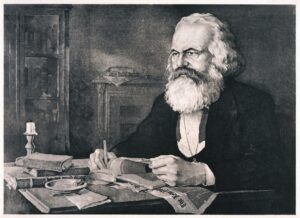
Marx war der erste, der die Geschichte auf eine materielle Grundlage stellte: Nicht der Staat formt die Gesellschaft, sondern die Gesellschaft bringt den Staat hervor. Diese Erkenntnis bedeutete einen Bruch mit der traditionellen Vorstellung vom „göttlichen Uhrwerk“, das das Landleben und die Jahreszeiten angeblich ewig gleich regeln sollte. In Wirklichkeit war es die Arbeitsteilung und die Klassenbildung, die den Lauf der Geschichte bestimmten – ein Prozess, der heute mit dem Fortschritt der Produktivkräfte immer offensichtlicher wird. Die alte Elite wird zunehmend überflüssig, weil sie die neuen Kräfte nicht mehr kontrollieren kann.
Die Zeit ist reif für eine neue Gesellschaft
In einer Welt voller Krisen wird deutlich: Die Menschheit braucht eine neue Gesellschaftsform – kollektiv, solidarisch, planvoll. Nur die Produzenten selbst können diese Gesellschaft aufbauen. Sie allein sind fähig, die Produktionsverhältnisse so zu gestalten, dass sie allen nützen, nicht nur einer kleinen Klasse.
Die Dialektik zeigt: Was heute noch mächtig erscheint – wie der Imperialismus – ist innerlich bereits morsch. Und aus dem Kleinen kann Großes entstehen. Der Kommunismus bedeutet nicht nur das Ende des Proletariats als Klasse, sondern das Ende aller Klassen. Denn Klassen entstehen durch Eigentumsspaltung – und diese wird im Kommunismus überwunden.
Erbe der Aufklärung – aber nicht ihr Ende
Auch die bürgerliche Aufklärung hat Spuren im kommunistischen Denken hinterlassen – insbesondere ihre Hinwendung zur Vernunft, zur Wissenschaft, zum Atheismus. Nach dem Erdbeben von Lissabon 1755 wurden viele Menschen vom Glauben an eine göttlich gelenkte Welt erschüttert. Der französische Materialismus, besonders vertreten durch den deutschen Baron Holbach, lehnte religiöse Vorstellungen ab und erkannte: Je mehr der Mensch die Natur beherrscht, desto weniger braucht er Götter.

Doch Holbach blieb in seinen politischen Ansichten ein Kind seiner Zeit – ein aufgeklärter Monarchist, der dem Volk keine aktive Rolle zutraute. Seine Religionskritik war naturwissenschaftlich, aber nicht gesellschaftlich fundiert. Die Erklärung sozialer Verhältnisse blieb ihm fremd. Marx ging darüber hinaus: Er verstand Religion nicht als Erfindung von Schwindelpriestern, sondern als Reaktion auf das reale Elend im Arbeitsalltag – als „Seufzer der bedrängten Kreatur“.
Vom Klassenkampf zur wissenschaftlichen Revolution
Einige bürgerliche Historiker der französischen Restaurationszeit begannen vorsichtig, den Klassenkampf als historischen Motor zu erkennen. Saint-Simon fügte 1802 den Besitzlosen als dritte Kraft zum bekannten Gegensatz zwischen Bourgeoisie und Feudaladel hinzu. Marx schließlich radikalisierte diesen Gedanken und formulierte 1847 gemeinsam mit Engels im Kommunistischen Manifest:
Die Geschichte aller bisherigen Gesellschaft ist die Geschichte von Klassenkämpfen.
Der entscheidende Mangel des mechanischen Materialismus der Aufklärung war seine politische Blindheit. Er glaubte, der Fortschritt komme durch gute Ideen. Marx aber erkannte, dass gesellschaftliche Veränderungen aus materiellen Verhältnissen hervorgehen – und dass Ideen, so wichtig sie auch sein mögen, stets den ökonomischen Verhältnissen untergeordnet bleiben.
Besonders gegen Hegel wandte Marx sich mit einer revolutionären Erkenntnis:
Nicht der Staat formt die Gesellschaft, sondern umgekehrt. Politik, Religion und Philosophie sind abgeleitet aus den ökonomischen Grundlagen der Gesellschaft – nicht umgekehrt.
Der Kapitalismus ist am Ende – und mit ihm die bürgerliche Wissenschaft
Die bürgerliche Aufklärung versuchte, Religion geistig zu erklären. Der Marxismus-Leninismus erklärt sie aus den Verhältnissen der Arbeit – aus Ausbeutung, aus Arbeitshetze, aus Ohnmacht. Die bürgerliche Wissenschaft versagt in ihrer Analyse, weil sie die ökonomische Grundlage systematisch ausklammert. Sie bietet keine Lösungen mehr – stattdessen bleibt nur schwammiges Gerede über „Religionswissenschaft“ und metaphysische Weltanschauungen.
Die Produktivkräfte wachsen unaufhörlich, ebenso die intellektuellen Anforderungen. Doch die Bourgeoisie ist heute rückständig, ideenlos, intellektuell ausgebrannt. Sie ist unfähig, die Herausforderungen der Gegenwart zu meistern. Das ist das eigentliche Drama.
Ohne ein klares Studium des Marxismus-Leninismus – und ohne praktisches Handeln auf seiner Grundlage – steuert die Menschheit dem Untergang entgegen. Und dieser wird nicht ästhetisch, sondern erbärmlich sein: im Elend, in der Zerstörung, im Chaos.
________________________
Ihr könnt dies Magazin unterstützen, indem ihr:
- Freunden, Bekannten, Kollegen und Gleichgesinnten
von diesem OnlineMagazin DER REVOLUTIONÄR erzählt; - Einen Link zu diesem Magazin an sie versendet;
- Die jeweiligen Beiträge teilt oder mit einem Like verseht;
- Eine Empfehlung in den sozialen Medien postet;
- Die Redaktion und Öffentlichkeitsarbeit durch Artikel,
Leserbriefe, Videoberichte und Kritiken unterstützt,
gerne auch als Gastartikel oder Volkskorrespondent; - Unsere Seite bei Facebook mit einem Like verseht;
(https://www.facebook.com/DerRevolutionaer);